WISSEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis gravida urna nulla, vel aliquet lorem sollicitudin vel. Maecenas elementum volutpat congue. Pellentesque vitae ultricies metus, tempus fringilla lorem. Nulla porttitor semper tortor vulputate accumsan. Aenean ac elit fermentum, faucibus magna et, tincidunt massa. Ut ornare gravida odio, sed luctus velit venenatis at. Suspendisse ac consequat mi. Etiam porttitor mattis interdum. Etiam eget ultricies nunc, a consequat tellus. Sed porttitor euismod enim, sit amet maximus sem commodo a. Sed non iaculis nulla. Donec vel neque sed nisl sollicitudin consequat. Suspendisse mollis vulputate interdum.
ERFAHREN SIE MEHR
SIGNATUR UND WESEN
/ Die Signatur ist der Ausdruck des Wesens
DIE DREI WIRKPRINZIPIEN
INFORMATION
Information ist ein geistiges Prinzip, das eine Wirkung verursachen kann. Sie wird meistens durch eine spezifische Struktur gespeichert und übertragen. Der geistige Sinn des Begriffs „Baum“ kann z.B. durch das Sprechen des Worts „Baum“ auf Deutsch oder in einer anderen Sprache übermittelt werden, wobei die Information
in der Struktur der Schallwellen verschlüsselt ist. Das gesprochene Wort kann auch auf einem elektronischen Datenträger gespeichert werden, wobei die Information in der Mikrostruktur des Datenträgers verschlüsselt ist. Dieser Begriff kann ausserdem mittels Schriftzeichen auf Papier gedruckt oder in Stein gemeisselt werden; in jedem Fall ist der geistige Inhalt durch Strukturen verschlüsselt bzw. codiert. Strukturen und Formen sind also Träger einer Botschaft, eines Sinns.
Wasser ist das Element des Lebens, denn es ist das Lösungs- und Transportmittel aller lebenswichtigen Stoffe in den Zellen und Gefässen. Obwohl die Wissenschaft bis heute noch keine Informationsstrukturen in Blut, Zellwasser oder Pflanzensaft direkt nachweisen konnte, sind wir aufgrund des Gesetzes der Analogie davon überzeugt, dass die biologischen Flüssigkeiten sowohl Speicher- als auch Übertragungsmedien von Informationen sind. Diese Informationen können – ebenso wie die Wirkstoffmoleküle – spezifische biologische Reaktionen auslösen. Die Information ist das Wirkprinzip in homöopathischen Verdünnungen, und aufgrund der Erfahrungen in der Homöopathie kann man annehmen, dass sie auf eine subtilere Weise als die Stoffe wirkt, obwohl ihr Wirkmechanismus noch nicht wissenschaftlich erkannt ist.
Die Information wird in erster Linie durch den Vermahlungsprozess in der Ceres-Mühle dynamisiert und auf das Arzneimittel übertragen.


ENERGIE
Ausser den physikalisch messbaren Energieformen wie Elektrizität, Wärme, Licht, Schall und Bewegung gibt es noch jene, die unsere Psyche bewegen, also Gefühle und Emotionen hervorrufen. Dazu gehört die Ausstrahlung von Farben, die Wirkung von Düften und Aromen oder die Harmonie von Proportionen. Alle Düfte und Aromen von Heilpflanzen haben aus diesem Grund eine die Heilung unterstützende Wirkung, auch wenn dies von der Wissenschaft noch nicht in jedem Fall nachgewiesen wurde.
Die Energie wird vor allem durch den Prozess der Reifung harmonisch abgerundet und dadurch verstärkt.
WIRKSTOFFE
Jede Heilpflanze hat zahlreiche Wirkstoffe, die wie ein gut eingespieltes Orchester zusammenwirken. Niemals ist es ein einzelner, der die Gesamtwirkung hervorruft. Manche Wirkstoffe sind empfindlich und können durch Erhitzung und Oxidation abgebaut werden. Die chemischen und pharmakologischen Eigenschaften der Wirkstoffe sind durch die Wissenschaft bereits weitgehend erforscht.
Die Wirkstoffe werden vor allem durch das Schneiden von Hand und die Extraktion mit der Ceres-Mühle bewahrt.

VIER QUALITÄTSPRINZIPIEN

PFLANZENQUALITÄT
Die Heilpflanzen stammen entweder aus Bio-, Demeter-Anbau oder kontrollierter Wildsammlung.
Jeder Standort wird mit Sorgfalt ausgewählt.
Mit viel Liebe und Erfahrung ernten wir die Pflanzen von Hand im optimalen Reifestadium.
HANDWERK
Die frischen Pflanzen werden direkt nach der Ernte verarbeitet.
Sie werden manuell gereinigt, verlesen und geschnitten.
Durch diese entschleunigte Verarbeitung bewahren wir die drei Wirkprinzipien: Wirkstoff, Information und Lebensenergie.


MÖRSERTECHNOLOGIE
Die Ceres Mörsermühle ermöglicht einen rhythmischen Mahlprozess in einem geschlossenen System, der das Mörsern und Verreiben bewahrend und schonend durchführt.
REIFUNG
Die Ceres Urtinkturen ruhen 2-3 Jahre,
um ihren Reifeprozess abzuschliessen. Dadurch wird das Aroma der Urtinkturen vollendet, und das volle Wirkspektrum kann sich optimal entfalten.

EINE HEILPFLANZE IST NOCH
KEIN ARZNEIMITTEL
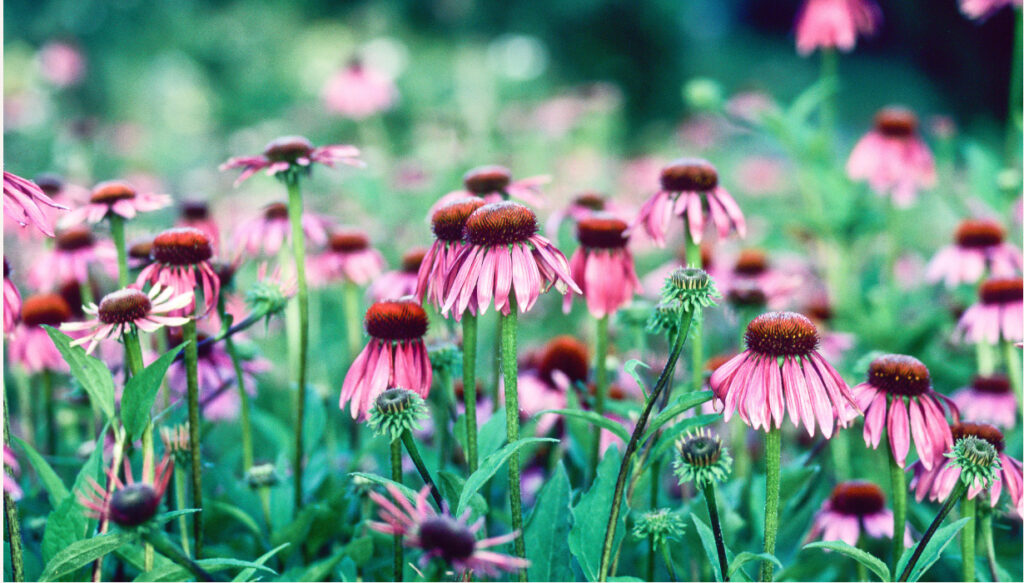
Das Leben auf der Erde hat einen sehr langen Weg der Evolution hinter sich, und es steht noch ein langer Weg bevor – ein Weg, auf dem der Mensch mitwirken kann. Viele Stufen auf dieser Strecke sind in den Heilpflanzen in verschlüsselter Form dargestellt. Wer sie zu entziffern vermag, findet in den Heilpflanzen einen Wegweiser und Begleiter auf dem Gang in die Zukunft.
DIE HEILPFLANZE –
EIN VIELSCHICHTIGES WESEN
Nähern wir uns zum Beispiel einer Goldrute, erkennen wir zuerst ihre Form, dann empfinden wir die Ausstrahlung ihrer Farben und ihres Dufts und beim Berühren schliesslich fühlen wir ihre feste Substanz. Nehmen wir dann die löslichen Stoffe in Form einer Zubereitung ein, erfahren wir – je nach Dosis – ihre heilende oder giftige Wirkung.
Die Wirkstoffe sind jedoch nur ein Teil des heilenden Potentials. Selbst die Goldrute im Garten ist nur ein Teil des Ganzen. Sie ist nur der physische Ausdruck einer geistigen Matrix, eines Pflanzenwesens, worin alle möglichen Eigenschaften der Goldrute als Prinzip enthalten sind. In der Heilpflanze selbst sind diese Eigenschaften nicht voll entfaltet, sondern nur angedeutet. Das gilt für alle Pflanzen: In der Süsse der Traube zeigt sich das Potential zu einem edlen Wein und in den Wirkstoffen der Goldrute das Potential zu einer ganzheitlichen Arznei.
Die Information wird in erster Linie durch den Vermahlungsprozess in der Ceres-Mühle dynamisiert und auf das Arzneimittel übertragen.


WIE KANN DAS POTENTIAL ENTFALTET WERDEN
Ziehen wir einen Vergleich zum Menschen. Viele haben Anlagen zu geistigen, künstlerischen oder handwerklichen Fähigkeiten. Diese gelangen aber nur dann zur vollen Entwicklung, wenn sie durch Ausdauer und Selbstüberwindung erworben werden.
Die Anlagen einer Pflanze können jedoch nicht durch die Pflanze selbst, sondern
nur durch den Menschen entfaltet werden. Die Entfaltung des Potentials in den Naturreichen geht Hand in Hand mit der Entfaltung des Potentials im Menschen. So wird die veredelte Natur zum Indikator der menschlichen Entwicklung, zum Spiegel
der Evolution des Bewusstseins, denn ohne Naturveredlung gibt es keine höhere Stufe des Menschseins und umgekehrt. Dabei darf Veredelung nicht mit Technik verwechselt werden. Eine Violine von Stradivari ist das edlere Produkt als eine elektronische Orgel. In der Pflanze sind also verschiedene Eigenschaften angedeutet, die der Mensch zur Entfaltung bringen kann um dadurch gleichzeitig sein eigenes geistiges Potential zu entfalten.
WESEN UND SIGNATUR DER HEILPFLANZEN
Das Wesen einer Pflanze ist der geistige Plan, nach dem sie gebildet und gestaltet wird. Darin ist alles, was die Pflanze ist und alles, was aus ihr werden kann als Prinzip, als Potential enthalten. Wenn der Same einer Pflanze in die feuchte Erde gelegt wird und
zu keimen beginnt, verbindet sich das kosmische Wesen mit dem Keimling. Erst diese Wechselwirkung zwischen dem Wesen und den Genen im Keimling macht das neue Lebewesen zur spezifischen, im Samen veranlagten Pflanze. Es sind nicht die Gene allein, es ist auch nicht das Wesen allein, was die Pflanze zur Pflanze macht, sondern die Wechselwirkung von beidem, von Wesen und Genen.


Ist dann die Heilpflanze voll entfaltet, enthält sie viele Wirk- und Duftstoffe, worin gewisse Aspekte des Pflanzenwesens zum Ausdruck kommen. Am vollständigsten aber kommt das Wesen in der Gestalt der Pflanze zum Ausdruck, in der sogenannten Signatur. In der Form der Pflanze ist ihr Wesen also verschlüsselt und wer diesen Code entziffern kann, wird in der Signatur das Wesen erkennen.
Das Lesen der Signatur der Pflanzen führt nicht unmittelbar zu Aussagen über
ihre Wirkungen auf die Organe, sondern vorerst zur Erkenntnis einer psychischen Entsprechung zwischen Pflanze und Mensch. Erst danach kann über die Beziehungen zwischen Psyche und Organen, über die sogenannte Psychosomatik auf eine organische Wirkung der Pflanze auf den Menschen geschlossen werden. Wenn man in den Formen der Pflanzen Organformen des Menschen sucht, findet man vielleicht Entsprechungen, doch diese sind eher zufällig. Diese triviale Art der Signaturenlehre hat nicht zu ihrem Ansehen beigetragen. Dabei ist doch die wahre Signaturenlehre nach Paracelsus die höchste Stufe der Erkenntnis. Er benennt drei Stufen, Erkenntnis zu gewinnen. Die erste Form ist die Erkenntnis vom Hörensagen. Es ist das, was man von anderen übernommen und gelernt hat, ohne es bereits durch Erfahrung bestätigt zu haben. Die zweite Stufe ist die Erfahrung. Sie ist von grösster Bedeutung, denn nur durch sie kann man das Gelernte bestätigen und vertiefen. Doch Paracelsus bezeichnet die Erfahrung als blind, weil sie nur die äusseren Eigenschaften und Zusammenhänge, aber nicht die dahinter liegenden geistigen Prinzipien erkennen kann. Das Lesen der Signatur hingegen – nicht nur in den Pflanzen, sondern in allen Dingen der Natur und des Lebens – ist die höchste Stufe der Erkenntnis, denn sie allein vermag die geistigen Prinzipien hinter den Erscheinungen zu erkennen.

CERES PFLANZENLEXIKON
ROSSKASTANIE
Aesculus hippocastanum L.
Botanik
Die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.) ist ein sommergrüner, relativ kurzlebiger Baum, der bis 35 m hoch werden kann. Er gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) und tritt in Mitteleuropa nur angepflanzt oder verwildert auf. Seine eigentliche Heimat ist Südosteuropa. Der Baum hat einen kurzen Stamm der oft Drehwuchs aufweist, sein Holz ist hell und weich. Aus seinen klebrigen Knospen entfalten sich im Frühjahr die typischen, grossen Laubblätter, die im Gegensatz zu allen einheimischen Baumarten gefingert sind. Die 5 bis 7 Teilblätter hängen anfangs schlaff nach unten, richten sich aber später auf und breiten sich dann waagrecht aus. Die Blüten erscheinen in den Monaten Mai bis Juni und stehen in reichblütigen Blütenständen zusammen. Die weissen Blüten weisen Saftmale auf, die zuerst gelb, nach der Bestäubung rot sind. Insekten erkennen diesen Farbumschlag und fliegen die bestäubten Blüten nicht mehr an. Früchte entwickeln sich nur in den unteren Teilen der Blütenstände, da wegen ihrer Schwere nur ein kleiner Teil der Blüten zu Früchten heranwachsen kann. Der Samen ist in eine grüne stachelspitzige Fruchtschale verpackt, welche sich beim Aufprall auf den Boden öffnet und den wunderbar glänzenden braunen Samen freigibt.
Inhaltsstoffe
Charakteristische Inhaltsstoffe für Aesculus hippocastanum L. sind die Triterpensaponine. Als wichtigster Inhaltsstoff wird Aescin angesehen. Darüber hinaus finden sich Flavonoide v.a. Glykoside des Quercetins und des Kämpferols. In den Samen der Rosskastanie kommen zudem auch Zucker, Stärke, Polysaccharide, fettes Öl, Proteine und Mineralstoffe vor.
Verwendung
Die Rosskastanie ist ein klassisches Venenmittel. Verwendet werden die Samen z.B. direkt als Tee oder in Form von Fertigarzneimitteln. Schwerpunkt der Anwendung in der Pflanzenheilkunde ist die chronisch venöse Insuffizienz. Die Homöopathie wendet Aesculus hippocastanum zudem bei Lenden- und Kreuzbeinschmerz an. Die Folgen des stagnierenden Blutrückflusses im Venensystem sind äußerst vielfältig. Im Bereich der Beine empfinden die Betroffenen zumeist Schwellung, Schmerzen, Schweregefühle und Juckreiz. Vielfach kommt es zu nächtlichen Wadenkrämpfen. Zudem besteht auch eine ausgeprägte Neigung zu Ödemen und Krampfaderbildung. In schwerwiegenden Fällen kommt es zu Thrombosen oder Ulcus cruris. Aus der Rosskastanie gewonnene Arzneimittel können hier aufgrund ihrer gefäßabdichtenden, ödemprotektiven, venentonisierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften Linderung verschaffen. Pfortaderstau und Hämorrhoidalleiden sind ebenfalls Teil des venösen Symptomenkomplexes. Bei Sportverletzungen mit lokaler Ödembildung und Blutergüssen kann Aesculus hippocastanum auch äußerlich angewendet werden.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Aufrichtekraft, Leichtigkeit, Selbstkontrolle, Sammlung, Ernst und Fröhlichkeit, Licht im Dunkel
Signatur
«Schon im Januar beginnen sich die Knospen der Rosskastanie stark zu vergrössern und mit einer glänzenden, klebrigen Schicht zu überziehen. Ihre pralle Wölbung verheisst eine reiche Substanzbildung. Wenn sie sich dann im Frühling weit öffnen und die Blätter aus ihrer Umhüllung entlassen, sind diese schon zu gross und schwer und doch noch zu schwach, um sich aufzurichten. Schlaff hängen die Teilblätter am schräg nach oben gerichteten Blattstiel nach unten. Wie die Glieder unbelebter Marionetten fallen die Teilblätter in sich zusammen, nur am einen Punkt des Stielendes gehalten. Nach und nach werden sie von einer aufrichtenden Kraft wie an Fäden emporgezogen, bis sie die richtige, waagrechte Lage einnehmen, um sich dem Sonnenlicht hinzuwenden.
Die Blätter sind handförmig gefiedert mit 5 bis 7 Teilblättern. Alle Teile entspringen einem zentralen Punkt am Ende des Blattstiels. Von hier aus wird die ganze Blattgestalt zusammengehalten, genährt und kontrolliert. Eine seltene Blattstruktur; meist verzweigen sich die Fiederblätter je seitlich von einer durch die Mitte der Blattkomposition geführten Achse. Haben sich die Blätter einmal in die Ebene ausgebreitet, ist die Blütenbildung schon fortgeschritten. Wie Blütenlichterkerzen schmücken die weissen Blütenstände Frühling für Frühling die Baumkronen der Kastanien. Aus der Nähe betrachtet, versuchen wir die Blüte in ihrer Struktur zu verstehen und nachzuvollziehen, wie sich die einzelnen Kron- und Staubblätter zueinander fügen. Ein schwieriges Unterfangen! Nur mit angestrengter Gedankenkraft wird die Ordnung der Rosskastanienblüte erfassbar. Doch vergessen wir die Botanik und geben wir uns der Ausstrahlung dieser Blüte hin. Ihre strahlend weissen Kronen mit den leuchtend roten und gelben Farbtupfern im Schlund sind einfach prächtig anzusehen. Später, im Sommer, hat die Rosskastanie mit ihrem dichten Blattwerk eine völlig geschlossene Baumkrone gebildet, die den Sonnenstrahlen jeglichen Durchgang auf den Grund verwehrt; ein perfekter Schattenspender. Deshalb ist dieser Baum so beliebt in Gartenrestaurants. Im Herbst freuen sich die Kinder an den prallen braunen Samen, den Kastanien. Umschlossen von einer fleischigen und stacheligen grünen Fruchtschale reifen die Samen heran. Dann spaltet sich die Fruchtschale und lässt die Samen zur Erde fallen. Der Glanz der frisch «geschlüpften» Kastanien verblasst nach kurzer Zeit; er scheint nicht für die Aussenwelt bestimmt, er wirkt im Innern der Frucht. Zusammengefasst erkennen wir in der Rosskastanie aufrichtende und zentral kontrollierende Kräfte sowie die Durchdringung des abgedunkelten Innenraums mit lichthaftem Weiss, leuchtenden Farben und spiegelndem Glanz.»
Wesen
«Die Rosskastanie besitzt die Kraft, den Menschen aufzurichten; sie bringt Prozesse, die der inneren Führung entgleiten, sich dadurch in Belanglosem, Unwichtigem verlieren und selbständig machen, wieder unter Kontrolle. Unkontrollierte, kreisende Gedanken und ein Mangel an innerer Führung werden durch das Wesen der Rosskastanie positiv beeinflusst ebenso wie das Blut, das infolge venöser Insuffizienz nicht mehr ungehindert zum Herz zurückfließen kann. Eine Schwäche der inneren Führung kann sich in einer oberflächlichen Fröhlichkeit (einem Mangel an Ernst) oder in einer übertriebenen Ernsthaftigkeit äußern. Das Wesen der Rosskastanie fördert den angemessenen Wechsel und das richtige Maß von Ernst und Fröhlichkeit. Der Aesculus-Typ ist ernstund tendenziell schwermütig. Er trägt Verantwortung mit großer Hingabe bis zur Verleugnung seiner eigenen Bedürfnisse. Es fehlt ihm die Leichtigkeit, er kann nicht spielerisch mit Situationen und Tatsachen umgehen und neigt zu Schuldgefühlen. Er empfindet ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle; mit belastenden Ereignissen beschäftigt er sich tagelang, «kaut sie wieder» und kann sie nicht loslassen. Er lässt sich zuweilen von der Last der Verantwortung niederdrücken, es können Kreuzschmerzen entstehen. Durch den Einfluss der Rosskastanie können Körper und Psyche wieder aufgerichtet werden. Die positive Energie der Rosskastanie wird symbolisiert durch das Kind, das noch spielerisch und mit Begeisterung jeder Situation mit Interesse und Neugierde begegnet. Es verbreitet eine sprühende, lichtvolle Freude. Mit derselben Leichtigkeit rollt die reife Frucht der Kastanie glänzend, rund und frisch aus der geplatzten Schale.»
FRAUENMANTEL
Alchemilla vulgaris aggr.
Botanik
Alchemilla vulgaris aggr. ist der Gemeine Frauenmantel. Die sehr ausdauernde Pflanze wird bis etwa 30 cm hoch. Im Frühjahr beginnt Alchemilla ihre grossen und charakteristischen, rundlich-nierenförmigen Blätter zu bilden. Diese sind zu Beginn der Entwicklung zunächst wie ein Fächer eingefaltet, später dann meist trichterförmig ausgebildet. Die Blattfläche selbst ist in einige dreieckig trapezförmige Lappen geteilt, der Blattrand ist gezähnt. Wie bei einer Perlenkette aufgereiht sind an den Blatträndern oft Wassertropfen zwischen den Zähnen zu finden. Dieses Wasser wird aktiv von der Pflanze ausgeschieden und kann sich wie eine grosse Perle am Grunde des Blattes sammeln, da dessen Oberfläche wasserabstossend ist. Die Pflanze blüht in den Monaten Mai bis September mit sehr vielen aber unscheinbaren Blüten. Die Blüten selbst sind nur 2 bis 4 mm lang und 3 bis 4 mm breit, sie sind gelbgrün gefärbt. So mag man kaum glauben, dass der Frauenmantel zu den Rosengewächsen gehört, die uns meist mit ihren nahezu perfekten Blütenkompositionen erfreuen. Eine weitere Besonderheit gibt es auch noch zu berichten: Im Moment der Entfaltung der Frauenmantel-Blüte ist diese bereits befruchtet und trägt den Embryo in sich, Alchemilla ist also nicht auf eine Fremdbestäubung angewiesen.
Inhaltsstoffe
Zu den charakteristischen Inhaltsstoffen des Frauenmantels gehören Gerbstoffe, vorwiegend Ellagitannine mit dem Hauptinhaltsstoff Agrimoniin, daneben Laevigatin F und Pedunculagin. Des Weiteren findet man Flavonoidglykoside.
Verwendung
Alchemilla ist eine wichtige Heilpflanze in der ganzheitlichen Frauenheilkunde. Es verwundert deshalb nicht, dass der Frauenmantel schon zu Zeiten der Germanen sehr geschätzt wurde und der Frigga, der Göttin der Natur und ihrer Fruchtbarkeit, geweiht war. Mit der zunehmenden Christianisierung wurden die traditionellen Anwendungen und Bedeutungen der Alchemilla von der Frigga auf die Jungfrau Maria übertragen. Der Schweizer Kräuterpfarrer Johann Künzle schreibt in seinem Buch: «Das Frauenmänteli stärkt die Muskeln der Frauen in geradezu auffallender Weise…». In der Literatur findet sich ein sehr breites Spektrum von Anwendungen für die Alchemilla in der Frauenheilkunde. Unter Anderem gehören Fluor, Menorrhagie, Unterleibsentzündungen und -schmerzen, unregelmäßige Menses, Erschlaffungszustände des Unterleibs, sowie Vor- und Nachbereitung von Geburten zu den typischen Anwendungsgebieten. Aus Sicht der Phytotherapie liefert der hohe Gerbstoffgehalt einen Hinweis für eine adstringierende, entzündungshemmende und antioxidative Wirkung. Daher wird der Frauenmantel pflanzenheilkundlich gerne bei Durchfallerkrankungen angewendet. Auch gemäß dem homöopathischen Arzneimittelbild wird der Frauenmantel bei Durchfall und Weissfluss eingesetzt.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Umhüllung, Behütung, Hervorbringung
Signatur
«Lassen Sie das Bild des Frauenmantels auf sich wirken! Bedarf es noch vieler Worte über die Signatur dieser Pflanze? Die gefässbildende Fältelung des Blattes spricht für sich und hat wohl immer wieder Anlass dazu gegeben, den Frauenmantel als überzeugendes Beispiel für die Signaturenlehre anzuführen. In dieser Hinsicht ist der Frauenmantel eine Ausnahme, denn die Signaturen der meisten Pflanzen erfordern eine sehr viel differenziertere Betrachtung. Auch die von den Wimpernhaaren des Blattrandes ausgeschiedene und sich im Blattgrund zum silbernen Tropfen vereinigende Flüssigkeit redet eine deutliche Sprache. Alchemilla verdankt ihren Namen der hohen Wertschätzung durch die früheren Alchemisten. Der Tautropfen aus ihrem Blattgrund wurde von ihnen gesammelt und als Ausgangssubstanz für die Herstellung von Elixieren verwendet. Sie ist gewissermassen die Alchemistin unter den Pflanzen. Einige weitere botanische Merkmale bringen ebenfalls das Wesen der Pflanze zum Ausdruck.
Die Frucht ist von einem weichen, glatten Kelchbecher umschlossen, mit diesem aber nicht verwachsen wie bei den anderen Gattungen und Arten aus der Familie der Rosaceae. Die Frucht entwickelt sich also geschützt, wie in einer Gebärmutter. Die meisten der zahlreichen Arten der Gattung Alchemilla sind apomiktisch, das heisst, sie entwickeln Früchte ohne Befruchtung. Sie entwickeln keinen normalen Pollen und die Staubbeutel platzen nicht, der Pollen wird nicht freigegeben.
Die Alchemillen sind sehr artenreich und unterscheiden sich oft nur durch schwer erkennbare Merkmale. Die exakte Bestimmung einer Pflanze ist meistens (selbst für erfahrene Botaniker) sehr aufwendig – oft sogar verwirrend – und generell nur möglich, wenn die Pflanze schon Früchte gebildet hat. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Alchemilla-Arten nicht klar definiert sind und einer starken Variabilität unterworfen sind, das heisst ihre Merkmale über die Generationen hin immer wieder leicht verändern. Es ist aber gerade das Gegenteil der Fall. Dem Fachbuch «Flora der Schweiz» von Hess, Landolt, Hirzel entnehmen wir: «Von allen Spezialisten der Gattung Alchemilla wird die Konstanz der kleinen Artunterschiede über grosse geografische Gebiete als einzig dastehendes Beispiel bei den Blütenpflanzen geschildert.» Die Alchemilla-Arten sind also – obwohl von schwer durchschaubarer Vielfalt – ausserordentlich stabil in ihrer Gestalt, sie sind in sich selbst ruhend.
Das lebensbewahrende Wesen kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Pflanze stark antioxidativ wirkende Substanzen enthält.»
Wesen
«Welche andere Pflanze könnte die Wesensart des gebärenden weiblichen Schoßes, der Gebärmutter, besser verkörpern als der Frauenmantel? Im geborgenen Grund ihres mantelartig umhüllenden, nach oben empfangend geöffneten, weichen Blattes bringt die «Alchemistin» (Alchemilla!) unter den Pflanzen in rhythmischer Gebärde einen silbernen Tautropfen hervor. Alchemilla steht für die Bejahung der weiblichen Rhythmen und des Frauseins. Frauen, die ihre Identität zu sehr auf ihre Gebärfähigkeit abstützen, oder Frauen, die Schwierigkeiten haben, diesen Aspekt ihres Frauseins zu integrieren, verhilft der Frauenmantel zu einer gewissen Distanz. Der Frauenmantel wirkt kühlend, das bedeutet, dass er körperliche und seelische überschießende Wärmeprozesse ausgleicht. Auch seine gewebestärkende Wirkung ist bekannt. Auf der seelischen Ebene stärkt er den Mut zur echten Weiblichkeit: Eine zu starke oder zu schwache Betonung des Frauseins wird ausgeglichen.»
BEIFUSS
Artemisia vulgaris
Botanik
Der Beifuss (Artemisia vulgaris L.) gehört zu den Korbblütengewächsen (Asteraceae) und ist mit dem Wermut (Artemisia absinthium) verwandt. Man findet ihn in der Natur oft auf Schuttplätzen, Wald- und Wegesrändern. Der Beifuss ist eine ausdauernde Staude mit einem mehrköpfigen, sehr harten Wurzelstock. Aus diesem treiben im Frühjahr aufrechte Stängel aus, die bis zu 2 m hoch werden können. Die am Stängel sitzenden Blätter sind fiederteilig lanzettlich und bis 10 cm lang. Am Rande sind sie häufig etwas eingerollt. Die Rosettenblätter sind eher fiederlappig und nicht so schmal. Die unscheinbaren Blütenköpfe sind eiförmig und gelb bis rötlich-braun. Die Pflanze blüht von Juli bis September.
Inhaltsstoffe
Der Beifuß, Artemisia vulgaris L., enthält ätherisches Öl, Sesquiterpene und Flavonolderivate. Er ist weit weniger bitter als das mit ihm verwandte Wermutkraut.
Verwendung
Artemisia vulgaris L. wurde volkstümlich und pflanzenheilkundlich hauptsächlich bei verschiedenen Verdauungsbeschwerden eingesetzt. In der Homöopathie wird der Beifuß bei Beschwerden durch Wurmbefall und Erkrankungen, die mit Krämpfen einhergehen angewendet. Im Lehrbuch der biologischen Medizin finden wir die gleichen Indikationen bestätigt: Erkrankungen des Verdauungsapparats und Wurmbefall, insbesondere wenn diese von Krämpfen begleitet werden. Der Beifuß kann darüber hinaus als Antispasmodikum bei Uterusbeschwerden und auch bei Amenorrhö zum Einsatz kommen. Es wird dem Beifuss ferner eine abortive Wirkung zugeschrieben.
GÄNSEBLÜMCHEN
Bellis perennis L.
Botanik
Das Gänseblümchen (Bellis perennis L.), gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae). Es ist eine ausdauernde Pflanze, die 5 bis 15 cm hoch werden kann und mit ihrer vitalen grundständigen Blattrosette das gesamte Jahr sichtbar bleibt. Aus den leicht fleischigen, verkehrt-eiförmigen Laubblättern entspringen die blattlosen Blütenstängel an deren Spitzen die 10 bis 30 mm grossen Blüten stehen. Das Innere der Blüten ist aus gelben Röhrenblüten aufgebaut, am Rand stehen die weissen Zungenblüten, welche oft noch rosa überlaufen sein können. Die Pflanze erfreut uns fast das ganze Jahr mit ihren Blüten (Januar bis November), die Hauptblütezeit liegt aber eindeutig im Frühling. Werden die Blüten abgemäht oder abgefressen, so treiben aus der vitalen Rosette sofort wieder neue Blüten aus. Häufige Bewirtschaftung fördert die Pflanze sogar, weshalb sie sich gerne in kurzgeschnittenem Rasen vermehrt.
Inhaltsstoffe
Zu den Hauptinhaltsstoffen von Bellis perennis L. gehören Triterpensaponine und Flavonoide (u. a. Glycoside des Apigenins, des Kaempferols und des Quercetins). Darüber hinaus konnten Gerbstoffe, ätherisches Öl, organische Säuren, schleimige und zuckerhaltige Verbindungen ebenfalls nachgewiesen werden.
Verwendung
Das Gänseblümchen ist schon seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Naturheilkunde und der Wildkräuterküche. Es handelt sich dabei um eine für Mensch und Tier ungiftige Heilpflanze. Bellis gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae), zu der auch viele weitere «Wundheilkräuter» wie Arnika und Calendula gehören. Es verwundert deshalb nicht, dass die phytotherapeutischen und homöopathischen Anwendungen von Bellis perennis L. viele Gemeinsamkeiten mit dem Wirkungsbild von Arnika aufweisen: Verletzungen, Schwellungen, Quetschungen, Verrenkungen, Verstauchungen und Blutergüsse. Als typische Empfindung gilt ein Wundheits- und Zerschlagenheitsgefühl im Bereich der Muskulatur. Die für Bellis charakteristischen Symptome sind zumeist die Folgen von Überanstrengung und Überarbeitung. Eine beliebte Form der Zubereitung für die innerliche Einnahme sind alkoholische Tinkturen und homöopathische Dilutionen bis D12. Die äußerliche Anwendung auf Muskeln und Gelenke ist ebenfalls sehr gebräuchlich. In der naturheilkundlichen Fachliteratur wird Bellis perennis L. auch zur Behandlung von Hautkrankheiten, vor allem bei Kindern, empfohlen. In der traditionellen Frauenheilkunde liegen gute Erfahrungen bei Gebärmutterblutungen und den Folgen von operativen Eingriffen vor.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Unberührtheit, Unschuld, Unversehrtheit, Kindlichkeit
Signatur
«Wer hat nicht als Kind Gänseblümchen gepflückt und daraus der Mutter ein Sträusschen gemacht? Klingt nicht ein ganz reiner, heller Ton in unseren Herzen an, wenn wir kleine Kinder dabei beobachten, wie sie Gänseblümchen pflücken und sich gegenseitig damit ihre Haare schmücken? Kinder fühlen eine innere Nähe zu dieser kleinen, bescheidenen Blume, die oft übersehen und getreten wird und sich dennoch ihre Unversehrtheit bewahrt. Das Gänseblümchen ist eine Rasen- und Wiesenblume. Es gehört zur artenreichen Familie der Korbblütler. Man kann den einfachen, klaren Aufbau des Blütenköpfchens wohl als Prototyp einer kindlichen Blume bezeichnen. Die Zungenblüten, beim Aufblühen rosa, werden später rein weiss, die Blütenscheibe ist ein einfacher, gelber Kreis. Wird der Rasen im Frühling zum ersten Mal gemäht
Auch neben dem Stamm der grossen Linde bewahrt das Gänseblümchen seine Reinheit.
und werden dabei die Blütenköpfchen abgehauen, geht es nicht lange, bis die Pflanze wieder neue Blüten bildet, nun aber mit kürzeren Stielen. Wird der Rasen noch kürzer gemäht, passt sich dieses Pflänzchen sofort wieder an. Es scheint unverwüstlich zu sein, es kennt nur eines: sein Blütenköpfchen nach oben zu recken und rein zu erhalten. Woher kommt diese Kraft, dieser Mut, dem man nichts anhaben kann? Die Pflanze hat eine ungewöhnlich widerstandsfähige Blattrosette, aus der sie immer wieder neue Kräfte mobilisiert.
Die zahlreichen Blätter sind alle bodenständig und bilden eine dichte Rosette. Beim genauen Betrachten der Blattstruktur nehmen wir scheinbar unvereinbare Eigenschaften wahr: derbe, fleischige Blätter, die dennoch einen starken Glanz ausstrahlen. Darin erkennen wir den Ausdruck von Robustheit und Vitalität. Beim Verblühen machen Pflanzen im Allgemeinen einen deutlich sichtbaren Wandel durch: Der Glanz der Farben und die Pracht der Formen weichen, die welken Blütenblätter mahnen an die Vergänglichkeit allen Lebens. Aber haben Sie schon einmal ein verblühtes Gänseblümchen gesehen? Natürlich machen sie keine Ausnahme – auch sie verblühen wie alles Leben. Doch ihnen ist es gegeben, derart diskret zu verblühen – die weissen Zungenblüten fallen ohne grosse Verfärbung rasch ab und das Gelb der Blütenscheibe nimmt das Grün des Rasens an –, dass sich die verblühten Pflänzchen wie unsichtbar in den Rasen einfügen. Das Gänseblümchen möchte also scheinbar nur Blüte sein und sich den Folgen des Fortpflanzungsprozesses (Welke und Reife) entziehen.»
Wesen
«Das Wesen des Gänseblümchens ist auf die Bewahrung der kindlichen Unschuld und Reinheit gerichtet. Es versucht sich vor Befleckung durch schuldhafte Verstrickungen, wie sie zum Älterwerden gehören, zu behüten. Da dies letztlich unmöglich ist, scheut es sich vor der Welt der Erwachsenen. So scheu und verletzlich es auch ist, kann es dennoch große Kräfte freisetzen, um die Folgen von Übergriffen auf seine seelische und körperliche Unversehrtheit zu heilen. Im anderen Namen dieser Pflanze, Maßliebchen, kommt zum Ausdruck, dass es in der Liebe Maß hält, das heißt, es dosiert die Leidenschaftlichkeit des Liebesverlangens, es dämpft die überschießende Potenz. Das Gänseblümchen ist eine wunderbare Hilfe bei allen seelischen und körperlichen Verletzungen, die durch ungestüme Gewaltanwendung, vor allem auch durch sexuelle Aggression entstanden sind.»
BIRKE
Betula pendula Roth
Botanik
Die Hängebirke (Betula pendula Roth) (Familie: Betulaceae Birkengewächse) ist ein Baum, der bis zu 30 m hoch werden kann. Birken sind sehr raschwüchsig und stellen oft die ersten Bäume die einen Landstrich besiedeln. So hat die Birke als einer der ersten Bäume nach den Eiszeiten Mitteleuropa wieder besiedelt. Heute kommt sie bevorzugt an Ufern von Gewässern, in Mooren und als Bestandteil von feuchten Wäldern vor. Ihr Stamm wird im Frühjahr intensiv von Säften durchströmt. Die Rinde junger Bäume ist schneeweiß und schält sich in horizontalen Streifen ab. Bei den älteren Bäumen weist vor allem der untere Stammteil eine rissige und wulstige Rinde auf, weiter oben ist sie hingegen glatt und weiß oder gelblichweiß. Die Äste der Birke stehen spitz winklig ab und sind stark überhängend. Die jüngsten Triebe weisen oft zahlreiche Harzdrüsen auf. Ihre Blätter sind im Umriss 3-eckig mit lang ausgezogener Spitze. Anfangs sind die Blätter sehr weich, dicht drüsig punktiert und klebrig. Hängebirken blühen in den Monaten April bis Mai mit kätzchenartigen Blütenständen, jedes Kätzchen kann mehrere Millionen Pollenkörner produzieren, die sehr weit verbreitet werden können. Eine Altbirke produziert auch mehrere Millionen Samen, die aber nur sehr kurzlebig sind. Die Birke vereint so überquellendes Leben und den Tod.
Inhaltsstoffe
Typische Inhaltsstoffe von Betula pendula Roth sind Flavonoide, wie Hyperosid oder Glykoside des Quercetins. Darüber hinaus sind Triterpenester, Phenolcarbonsäure und Ascorbinsäure enthalten. Auch Mineralien sind nachweisbar, darunter vor allem Kaliumtartrat. In den Birkenblättern finden sich auch kleine Mengen ätherischen Öls.
Verwendung
Die Blätter der Birke werden in der Pharmazie frisch oder getrocknet in Form von Kräutertees, pulverisiert oder zur Herstellung von Trocken- oder Fluidextrakten verwendet. Der Schwerpunkt der Wirkung der Birkenblätter liegt vorrangig auf einer Steigerung der Diurese bzw. Aquarese. Deshalb eignen sie sich auch für die Durchspülungstherapie bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege. Die Steigerung der Nierenleistung in Kombination mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr kann auch dabei helfen, die Bildung von Nierengriess zu vermeiden. In der naturheilkundlichen Fachliteratur werden Arzneizubereitungen aus Hängebirke „Folia Betulae“ auch zur begleitenden Behandlung von rheumatischen Beschwerden und Hauterkrankungen empfohlen. Dies verwundert nicht, da gerade eine Ausscheidungsschwäche der Niere bei den vorgenannten Krankheitsbildern vielfach eine Mitursache darstellt.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Qualität, Ästhetik, Polarität von Leben und Tod
Signatur
«Welches Kind kennt sie nicht, die Birke, den einzigen Baum mit weisser Rinde? Weiss ist die Farbe der Reinheit, der Unberührtheit, des Brautkleids. Es ist die Farbe der Verheissung, denn das weisse Licht kann sich teilen in die fundamentalen Farben des Regenbogens. Weiss ist keine seltene Farbe im Pflanzenreich, es gibt zahlreiche schöne weisse Blüten. Der Begriff blütenweiss gilt als Synonym für höchste Reinheit. In der weissen Blüte begegnet uns ein Bild verheissungsvollen jungen Lebens. Ansonsten finden wir die weisse Farbe vor allem in der unbelebten Natur, wie zum Beispiel im Schnee. Der Anblick einer frisch verschneiten Landschaft berührt uns feierlich. Wir spüren die Reinheit, Frische und Erneuerung, die von der sanften, im Sonnenschein glitzernden Schneedecke ausgehen. Doch es wäre ein voreiliger Schluss, das Wesen der Birke – wegen ihrer weissen Rinde – mit Reinheit zu bezeichnen. Bevor wir die Bedeutung der weissen Birkenrinde deuten können, müssen wir das Wesen der üblicherweise braunen Rinde verstehen. Wenn wir einen Apfel aufschneiden und an der Luft stehen lassen, verfärbt er sich braun; die lebensabbauenden Oxidationsprozesse ergreifen die verletzten Zellen an der Schnittstelle des Apfels. Braun begleitet im Pflanzenreich immer den Abbau. Die Rinde ist braun wie die Erde, der Humus und besteht aus abgebautem Pflanzenmaterial, das nicht mehr von den Lebenssäften durchströmt wird. Die Rinde hat also eine wesenhafte Verwandtschaft mit der Erde. Beide befinden sich auf dem Weg von lebendiger Substanz zu mineralischer Substanz. Heisst dies nun, dass die weisse Birkenrinde noch blütenhaft und nicht erdhaft abgebaut ist? Nein, im Gegenteil. Denn schreitet der Abbauprozess weiter, entsteht als letzte Stufe das Mineral, die reine weisse Asche. In der Birke sehen wir einen Baum, dessen Rinde die vollständige Auflösung des Lebendigen symbolisiert, den Tod. Damit kommen wir zu der anderen Bedeutung von Weiss, wie sie vor allem in östlichen Kulturen erkannt wird, als Farbe der Trauer und des Todes. Jetzt erst haben wir ein vollständiges Bild dieser Farbe, denn in ihr liegt die Polarität des Anfangs und des Endes des Lebenskreises, der Verheissung des Lebens und des Todes. Scheinbar ferne Gegensätze liegen in Wirklichkeit nahe beieinander, denn sie werden durch die immerwährende Bewegung des Lebens zum Kreis geschlossen. Zwischen diesen Polen – beide symbolisiert durch Weiss – spannt sich die Lebenskraft, die uns bewegt. Das Wesen der lebendig kreisenden Bewegung ist es also, was uns in der Birkenrinde symbolhaft begegnet. Leben heisst Bewegung, Veränderung, Flexibilität. Die Birke ist ein äusserst beweglicher Baum. Besonders bei der Hängebirke – welche die arzneilich verwendeten Blätter liefert – sehen wir eine tänzerische Anmut der Bewegung, wenn der Wind durch ihre Zweige fährt. Die Zweige sind fein und elastisch, deshalb bedient man sich ihrer auch zur Herstellung von Reisbesen und Ruten. Im Frühling sind die Birken reich durchströmt von einem Überfluss an lebenserweckendem Saft, der oft zur Entschlackungskur getrunken wird. (Das zu diesem Zweck erforderliche Anzapfen der Birken sollte nur von Fachleuten vorgenommen werden, um den Baum nicht zu schädigen.) Die Birkenblätter verbreiten einen besonders lieblichen, süsslichen Duft, der unsere Seele mit Verjüngungskräften durchströmt.»
Wesen
«Die Birke vereint in sich die Gegensätze von Leben und Tod. Sie trägt Zeichen jung strömenden Lebens ebenso wie solche des Abbaus und der Mineralisierung. Wie ist es der Birke möglich, eine solch große Spannweite zu umfassen? Sie wurde in den Mythen oft als anmutig tanzende Jungfrau mit goldenem Haar dargestellt (Betula bedeutet hebräisch junges Mädchen). In der geschmeidigen Bewegung der Zweige im Wind, im goldgelben Frühlings- und Herbstkleid und in der reinweißen Rinde können wir diesen Vergleich nachempfinden. Tanz ist Rhythmus, Schwingung, Vibration. Anmutiger Tanz, ästhetische Gestalt, Ausstrahlung ist ein Bildnis von reiner Qualität, von Seelenkraft, die alle Gegensätze vereint. Es ist das seelische Prinzip, welches das Geistige mit der Materie verbindet, das Tote zum Leben erweckt und zwischen den größten Polaritäten vermittelt. Das Wesen der Birke ist Qualität. Unter dem Einfluss dieses Baumes empfindet die Seele Farben leuchtender, Töne klangvoller, Düfte aromatischer. In seinem Wirkungsbereich erscheinen Gestalten lebendiger, unsere Sinne werden befähigt, Ästhetik und Harmonie zu erschauen. Birkenblättertinktur ist das angezeigte Mittel, wenn die Welt als matt und grau empfunden wird, wenn man von Kräften der Erstarrung und Kälte zu sehr umklammert wird. Lässt der jugendliche Schwung in den Gedanken und Gefühlen nach, geht die Freude an der körperlichen Bewegung verloren, dient die Birke als reich fließender Quell neuer Kräfte. Die Birke erreicht aber auch den gegensätzlichen Menschentyp, der zu leichtfüßig, zu tänzerisch durchs Leben geht. Den Menschen, dem das Leben eine Bühne zur Selbstdarstellung ist, der tiefe Bindungen scheut, der wie ein Schmetterling nach der Süße des Lebens hascht und dessen herbe Seiten verdrängt. Durch sein unverbindliches Verhalten hat er keinen tiefen Anteil am gemeinschaftlichen Band der Freundschaft und des Interesses, das die Menschen verbindet. Verbindung und Freundschaft wird im Organsystem von den Nieren repräsentiert. In der Aktivierung der Nierentätigkeit durch Betula erhalten solche Menschen die Möglichkeit, sich tiefer mit dem Leben und den Menschen zu verbinden.»
RINGELBLUME
Calendula officinalis L.
Botanik
Die Ringelblume (Calendula officinalis L.) gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae). Sie ist eine einjährige Pflanze mit einem charakteristischen Geruch, der an den Duft von Harz erinnert. Berührt oder erntet man die Pflanze, so wird die Haut sofort mit dieser balsamisch duftenden, klebrigen Substanz überzogen. Die Ringelblume wird 30 – 70 cm hoch, an einem aufrechten, filzig behaarten Stängel stehen die ungeteilten spatelförmig, bis lanzettlichen Blätter. Die Ringelblume blüht von Juni bis in den Oktober hin und erfreut uns mit ihren 2 – 5 cm grossen, strahlenden, gelben, bis orangefarbenen Blüten, die von aussen nach innen aufblühen. Sie ist eine so vitale Pflanze, dass sie immer wieder neue Blüten hervorbringen kann, sofern man die alten Blüten regelmässig entfernt. Typisch für einen Korbblütler sind die Blüten, die in Wahrheit keine Einzelblüten, sondern Blütenstände sind, aus Zungen- und Röhrenblüten zusammengesetzt. Im Unterschied zu den anderen Arten der Pflanzenfamilie sind bei der Ringelblume die eigentlich fruchtbaren inneren Röhrenblüten unfruchtbar, während die äusseren Zungenblüten fruchtbar sind. Als weitere Besonderheit bildet die Pflanze verschieden geformte Fruchttypen aus.
Inhaltsstoffe
Bei der Ringelblume findet sich ein Spektrum verschiedener Inhaltsstoffe wie Triterpenalkohole, Triterpensaponine, Flavonoide, Polysaccharide und kleine Mengen von ätherischem Öl, bestehend aus Sesquiterpenen. Die Färbung wird durch gelbe Xanthophylle und orangefarbene Carotinoide hervorgerufen.
Verwendung
Die bereits seit Jahrhunderten in Kräutergärten kultivierte Ringelblume gehört zu den bekanntesten wundheilungsfördernden Heilpflanzen überhaupt. Calendula kommt dabei als getrocknete Teedroge und aufgrund der schönen gelben Farbe auch als Schmuckdroge in Kräuterteemischungen zum Einsatz. Weitere übliche Formen der Zubereitung sind Fluidextrakte und alkoholische Tinkturen. Darüber hinaus wird durch Mazeration mit pflanzlichen Ölen (z.B. Olivenöl) aus den Ringelblumen das Calendulaöl zur äusserlichen Anwendung gewonnen. Aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften zählen Verletzungen und schlecht heilenden Wunden im Bereich von Haut und Schleimhaut zu den Anwendungsschwerpunkten. Dabei eignet sich sowohl die innerliche wie auch die äusserliche Anwendung. Für die Anwendung zur Schleimhautpflege im Bereich von Mund und Rachen eignen sich Teezubereitungen oder Gurgellösungen, die ganz einfach mit einigen wenigen Tropfen der Tinktur hergestellt werden können. Äußerlich werden, die arzneiliche Zubereitungen aus Calendula officinalis enthalten, lokal auf der Haut angewendet.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Balsam, Verschliessen von Wunden
Signatur
«Die Ringelblume ist eine sehr beliebte Gartenpflanze, die wenig Ansprüche an Standort und Pflege stellt. Wenn man sie sich selbst überlässt, sorgt sie für sich und sät sich immer wieder neu aus. So kann sich unser Auge und Herz vom frühen Sommer bis zum späten Herbst an ihren leuchtenden gelben und orangen Farbtönen erfreuen. Die Leuchtkraft der Farben bringt pure Lebenslust und wahre Sinnenwärme zum Ausdruck. Eine grössere Fläche von dicht an dicht stehenden Ringelblumenblüten hat eine Ausstrahlung von ungebrochener Lebendigkeit, die wohl kaum zu übertreffen ist. Man kann vor dem inneren Auge förmlich sehen, wie das intensive Lebensenergiefeld über der Oberfläche der Blüte in flächiger Bewegung webend wirkt. Nicht nur die Blüten haben einen besonderen Bezug zur Peripherie. Nimmt man ein Bündel geschnittener Pflanzen in die Hand und drückt sie mehrmals ein wenig, bemerkt man eine leicht klebrige, balsamische Substanz, die alle Pflanzenteile überzieht und ein wunderbar warmes Aroma verbreitet. Haben wir oben von der ungebrochenen Vitalität und Fruchtbarkeit der Ringelblume gesprochen, kommen wir nicht umhin zu erwähnen, dass die inneren Röhrenblüten des Blütenkorbs (Calendula gehört zur Familie der Korbblütler) unfruchtbar sind. Ein Widerspruch? Nein, ein wunderbares Zeichen der Signatur, denn nun erfahren wir, woher die Ringelblume ihren Namen hat. Ihre Früchte krümmen und ringeln sich und werden ganz unterschiedlich gross. Die Früchte der fruchtbaren Randblüten krümmen sich alle mehr oder weniger weit nach innen, bis sie die ganze unfruchtbare Innenfläche vollständig zugedeckt haben. Wenn man es nicht genau untersucht, käme man gar nicht auf die Idee, dass die Ringelblumenfrüchte nicht aus der ganzen Blütenscheibe stammen. Einen weiteren «Verschlussmechanismus» bemerken wir, wenn wir Blüten sammeln und sie am Stiel abschneiden. Nach kurzer Zeit hat sich an der Schnittstelle ein weisser, abdichtender Überzug gebildet. An der Schnittstelle austretender Pflanzensaft hat sich zu einer kompakten Schicht verfestigt. Es versteht sich von selbst, dass sich eine Pflanze mit derart eindrücklicher Wesenskraft nicht nur auf das Verschliessen von körperlichen Wunden versteht. Auch seelische Wunden erfahren durch diese sonnenhafte Pflanze eine Linderung.»
Wesen
«Wohl kaum eine andere Pflanze ist von ihrer Natur her so vorzüglich zum Wundheilkraut geeignet. Ihr balsamisches, warmes Wesen ist völlig auf das Verschließen von Verwundungen ausgerichtet. Wie mit Lichtfäden schliesst die Pflanze das gestörte Energiefeld über der Wunde und versorgt es mit neuen Kräften, um eine rasche Heilung zu fördern. Die geringelten Früchte der Ringelblume bedecken den Blütenboden von außen nach innen und verschließen die offene, «wunde» Stelle im Innern. Fasst man eine Ringelblume mit den Händen, um sie zu pflücken, hinterlässt sie auf der Haut ein einzigartiges, klebriges Sekret. Ihre Fähigkeit, Wunden zu «verkleben» und zu verschließen, ist herausragend. Sie besitzt eine intensive innere Wärme und wirkt dadurch entzündungswidrig und desinfizierend. Sie enthält Sonnenkraft, bildet sie doch die dauerhaftesten Blüten im Kräutergarten und trotzt gar noch der Novemberkälte. Calendula heilt Hautrisse, fördert die Wundheilung und wirkt mit ihrer tröstenden, balsamischen Kraft bis in seelische Prozesse.»
MARIENDISTEL
Carduss
Botanik
Die Mariendistel, mit botanischem Namen Silybum marianum (L.) GAERTN., gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Es handelt sich bei ihr um eine einjährige, selten zweijährige Pflanze die eine imposante Pflanzengestalt von bis zu 2.50 m Grösse entwickeln kann. Sie bildet nach der Keimung zunächst eine Pfahlwurzel und eine dem Boden aufliegende Rosette aus. Aus dieser Rosette entsteht dann ein kräftiger aufrechter Stängel, der sich etwa ab der Mitte verzweigt. Am Stängel stehen die länglich-elliptischen, buchtig fiederteiligen Blätter. Alle Blätter der Pflanze weisen mehrere Besonderheiten auf: Zunächst sind sie nicht rein grün, wie man es von pflanzlichen Blättern sonst kennt, sie weisen Bereiche auf, in denen das Chlorophyll fehlt und die dadurch weiss «gefärbt» sind. Ausserdem sind die Blätter nicht flach, wie es typisch wäre, sie sind stattdessen dreidimensional aufgewölbt und zeigen dadurch einen welligen Blattrand. Vor allem der Blattrand ist mit gelblichen Stacheln bewehrt, die sehr lang und spitz sind. Eine unachtsame Begegnung mit der Mariendistel vergisst man nicht so schnell! An den Spitzen der Stängel sitzen die purpurfarbenen, 4 bis 6 cm grossen, eiförmigen Blütenköpfe, die nur aus Röhrenblüten zusammengesetzt sind. Auch die Blütenstände, welche von Juli bis August blühen, sind mit den scharfen Stacheln bewehrt. Nach dem Verblühen, wenn die Samen der Pflanze mit der Ausreifung beginnen, klappen die Röhrenblüten um, verkleben und bilden ein Dach über den Samen, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
Inhaltsstoffe
Charakteristisch für die Mariendistel ist ihr Gehalt an Lignanen. Darunter ist Silymarin – ein Stoffgemisch aus Silibininisomeren und -derivaten – am bekanntesten und am besten erforscht. Weitere Flavonoide, wie Quercetin sind ebenfalls enthalten. Darüber hinaus sind die Samen bzw. Früchte der Mariendistel auch reich an fetten Ölen.
Verwendung
Die Mariendistel ist als eines der Hauptmittel bei Erkrankungen der Leber und Gallenwege bekannt. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören dyspeptische Beschwerden und toxische Leberschäden. Leberbedingte Kopfschmerzen, Übelkeit, Verdauungsstörungen und Varizen zählen aus naturheilkundlicher Sicht zu den bewährten Anwendungsgebieten. Die Mariendistel wird auch homöopathisch bei Leber-Galle Erkrankungen eingesetzt. Darüber hinaus wird die Mariendistel gemäß homöopathischem Arzneibild bei Hämorrhoiden und Krampfaderleiden, sowie bei Rheumatismus der Schulter und der Hüfte angewendet. Pflanzenheilkundliche Zubereitungen aus Mariendistelfrüchten werden unterstützend bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen und Leberzirrhose eingesetzt. Silybum marianum (L.) GAERTN. gehört zu den besonders gut erforschten Heilpflanzen. Der schützende Effekt auf die Leberzellen wird durch folgende drei Eigenschaften erklärt: Stabilisierung der Leberzellmembran, Radikalfänger- und Antioxidansfunktion und Beschleunigung der Leberzellregeneration. So liegt in der Mariendistel das Potential einer Belastung mit leberschädigenden Substanzen entgegenzuwirken. Diese Eigenschaft macht man sich bei der Anwendung von Silibinin bei Knollenblätterpilzvergiftungen zu Nutze.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Abgrenzung, Schutz, Individualität
Signatur
«Die Mariendistel bevorzugt warme, trockene Standorte; sie stammt aus dem Mittelmeergebiet, wo sie weit verbreitet ist. In Mitteleuropa wird sie gelegentlich angebaut. Die Mariendistel ist eine starke Pflanzenpersönlichkeit. Mit ihrer stattlichen Größe und den äußerst wehrhaften Stacheln verschafft sie sich Respekt und hält Mensch und Tier in sicherem Abstand. Mit ihren charakteristischen zweifarbigen, zähen Blättern trägt sie den Stempel betonter Individualität: Sie kann nicht übersehen oder verwechselt werden. Wer einmal eine Mariendistel gesehen hat, vergisst sie nicht wieder. Die Signatur der Mariendistel bringt das Wesen von Schutz, Abgrenzung und Individualität deutlich sichtbar zum Ausdruck. Wie viele andere Distelarten ist sie an den Blütenkörben und den Blättern mit Stachelspitzen bewehrt. Die Abwehrfunktion ist so vollendet wie bei kaum einer anderen Distel. Schon bei einer leichten Berührung dringen die Stacheln in die Haut. Sie sind so scharf, hart und lang, dass man sich der Pflanze nur mit äußerster Vorsicht nähern kann. Bei der Ernte der reifen Blütenköpfchen bekommt man diese Wehrhaftigkeit trotz Schutzkleidung oft schmerzhaft zu spüren. Die Blätter sind sehr fest, glänzend und wirken dauerhaft wie die Blätter oder Nadeln winterharter Gewächse. Die charakteristische Färbung der Blätter ist das sicherste Erkennungszeichen der Mariendistel. Das satte Grün wird entlang der Blattnerven von einem Netzwerk breiter, weißer Streifen überzogen, die die Blattnerven markieren. So liegt das eigentliche Blattgrün wie Inseln verteilt in diesem weißen Bändernetz. Man erkennt also in den Blättern farblich klar voneinander abgegrenzte Zonen. Der Blattrand ist nach innen gebuchtet und weit über die Blattebene hinaus aufgeworfen, so dass der Blattumfang, die Blattgrenze deutlich vergrößert und betont wird. Eine sanftere Form der Abwehr und des Schutzes finden wir im Inneren der Blütenköpfchen. Die purpurnen, leicht klebrigen Röhrenblüten machen nach dem Verblühen eine überraschende Veränderung durch. Die Farbe wandelt sich von Purpur über Blau zu Grau. Gleichzeitig legen sich die kleinen, röhrenförmigen Blütenblätter – ausgehend von der Mitte der Köpfchen – radial nach außen um und verkleben miteinander. Auf diese Weise bilden sie als Schutz für die reifenden Früchte ein regendichtes Dach, das wie ein perfektes, kegelförmiges Strohdach aussieht.»
Wesen
«Die Mariendistel fördert die Fähigkeit, sich gegenüber emotionaler und physischer Ausbeutung, gegen über Angriffen und Manipulationen angemessen zu behaupten. Sie unterstützt die Wahrung der eigenen Persönlichkeit, indem sie die aktive Abgrenzung gegenüber schädigenden psychischen Einflüssen stärkt. Zu beachten ist, dass sich eine psychische Abwehrschwäche auf gegensätzliche Arten äußern kann, entweder in der Unfähigkeit zur Abgrenzung und zum Neinsagen oder aber in einer übersteigerten, aggressiven Abgrenzung. Eine solche Schwäche kann zu einer Störung der Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktionen der Leber führen und damit Ursache von chronischen Krankheiten sein.»
TAUSENDGÜLDENKRAUT
Centaurium erythraea RAFN
Botanik
Centaurium erythraea RAFN, das Echte Tausendgüldenkraut, gehört zu den Enziangewächsen (Gentianaceae). Die Art ist insgesamt eher selten und tritt vor allem an Waldrändern, Waldschlägen, sonnigen Waldlichtungen und mageren Wiesen auf. Sie klettert nicht so weit ins Gebirge hinauf, wie ihre Verwandten aus der Familie und bleibt eher in flacheren Bereichen. Es ist eine krautige Pflanze, die bis maximal 50 cm hoch wird. Aus einer hellen Pfahlwurzel bildet sich ein aufrechter, vierkantiger Stängel der sich nach oben hin verzweigt. Der Stängel ist kantig und äusserst zäh. Am Boden bildet sich eine Rosette aus verkehrt-eiförmigen Laubblättern, die aber zur Blütezeit oft bereits verwelkt ist. Die Stängelblätter stehen kreuzgegenständig und sind eher länglich-eiförmig. Die gesamte Pflanze ist kahl. Wie kleine, intensiv rosa leuchtende fünfzählige Sterne entfalten sich von Juli bis in den September hinein die Blüten an der Pflanze. Die recht einfach gebauten Blüten mit ihrer klaren Struktur stehen in einem lockeren, trugdoldigen Blütenstand zusammen, die Blumenkrone ist verwachsen. Zieht man vorsichtig an einem rosa Blütenzipfelchen, so löst sich direkt die ganze Krone heraus. Die kleinen Blüten öffnen sich nur bei warmer und sonniger Witterung. Unvergesslich ist der Moment, wenn man das Kraut der wunderschönen und strahlenden Pflanze probiert. Es hat ein intensives Aroma, welches man dieser Pflanze so gar nicht zutrauen möchte: Es schmeckt intensiv gallbitter.
Inhaltsstoffe
Centaurium erythraea RAFN gehört zu den Heilpflanzen mit einem stark bitteren Geschmack. Mit einem Bitterwert von 2000 bis 10000 ist die Bitterkeit des Tausendgüldenkrauts einiges stärker als die der Löwenzahnwurzel, jedoch nicht ganz so stark wie diejenige von Enzian oder Wermut einzustufen. Verantwortlich hierfür sind Secoiridoidglykoside, wobei Swertiamarin mengenmäßig die Hauptkomponente darstellt. Des Weiteren findet man typischerweise polymethoxylierte Xanthone und Flavonoide.
Verwendung
Das Tausendgüldenkraut wird schon seit Jahrtausenden von berühmten Arzneikundigen wie Hippokrates oder Paracelsus als Heilmittel verwendet. Die bittere Pflanze wird als Volksmittel, pflanzenheilkundlich und auch homöopathisch typischerweise bei Magenbeschwerden angewendet. Die Einnahme von Bittermitteln führt zu einer Steigerung der Magensaft- und Speichelsekretion. Dadurch lässt sich der Einsatz von Centaurium erythraea RAFN bei Appetitlosigkeit und dyspeptischen Beschwerden erklären. Neuere Untersuchungen zeigten auch, dass die Wirkung von Bittermitteln weit über die sogenannte reflektorische Wirkung über die Wahrnehmung der Bitterkeit hinausgeht. So ist besonders auch die Anwendung von bitterstoffhaltigen Pflanzen bei depressiven Verstimmungen und als allgemein tonisierende Mittel zur Kräftigung von Körper und Geist von grosser Bedeutung. Häufig wird die getrocknete Pflanze für die Arzneizubereitungen (z.B. zur Zubereitung eines Infuses) verwendet. In der Homöopathie dient als Ausgangsmaterial die frische Pflanze.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Idealität und Realität
Signatur
«Das Tausendgüldenkraut ist eine Heilpflanze, deren Wesen nur verstanden werden kann, wenn man sie im Zusammenhang mit ihrem natürlichen Standort betrachtet. Das Tausendgüldenkraut gehört zur Familie der Enziangewächse, deren Vertreter meist Bergpflanzen sind, also in den «erhabenen Gefilden» der höheren Regionen zuhause sind. Die meisten Enzianarten empfinden wir als schlicht und schön. An ihrem natürlichen Standort, auf Bergweiden, kommen sie wunderbar zur Geltung. Das Tausendgüldenkraut ist nun ein Enziangewächs, das den angestammten Familiensitz verlassen und sich in den Niederungen angesiedelt hat. Seine Standorte sind Kahlschläge, Wegränder, grasige Hänge und Riedwiesen. Da die Pflanze im Hochsommer blüht und nur etwa 10 bis 40 cm gross ist, wird sie zur Blütezeit umgeben oder gar überwuchert von Gräsern und Dornengestrüpp. Sie kommt also im Unterschied zu den in den Bergen gebliebenen Familienmitgliedern in ihrer Umgebung viel weniger zur Geltung. Der Stengel hat sich dieser Umgebung vollkommen angepasst. Er ist kantig, drahtig und zäh. Wer einmal Tausendgüldenkraut geerntet hat, ist überrascht vom kräftigen Stengel, der nicht zu den zarten Blüten zu passen scheint. Lassen wir nun das Bild der Blüten auf uns einwirken! Kann man sich eine vollkommenere Synthese von schlichter Klarheit mit edler Ausstrahlung vorstellen? Der Adel, die Aura dieser Blüten wird nicht durch komplexe Strukturen bewirkt, sondern durch Schlichtheit und Klarheit der Form sowie durch den Glanz und die Zartheit des rosaroten Farbtons der Blütenblätter und die Leuchtkraft des Gelbs der Staubblätter. Die Blüte des Tausendgüldenkrauts ist von ergreifender Schönheit. Es besteht ein grosser Gegensatz zwischen Standort und Stengel der Pflanze einerseits und ihrer Ausstrahlung andererseits. Ein Tausendgüldenkraut in seiner natürlichen Umgebung im Gestrüpp zu finden (die Pflanze ist selten), ist für mich jedes Mal eine freudige Entdeckung. So mag das Gefühl sein, wenn man einen Edelstein gefunden hat. Im Wesen dieser schlichten Pflanze liegt die Kraft verborgen, eine Brücke zwischen der Klarheit des Geistes und dem wuchernden Lebensdrang zu schlagen.»
Wesen
«Treffender könnte der wissenschaftliche Name des Tausendgüldenkrauts nicht sein. Das Wesen dieser hoch geschätzten Heilpflanze kommt im Zentaur – dem Doppelwesen zwischen Pferd und Mensch aus der griechischen Mythologie – wunderbar zum Ausdruck. Der Zentaur symbolisiert den Zwiespalt des menschlichen Daseins: Auf der einen Seite manifestiert sich eine Körpergestalt mit Instinkten und Bedürfnissen, die gleich derjenigen der Tiere allen Gesetzen der Schwerkraft unterworfen ist. Andererseits aber birgt der menschliche Körper – und dadurch erhebt sich der Mensch über das Tier – ein See lenleben in sich, das sich im Streben nach Kultur, nach Schönheit und Harmonie, in der Sehnsucht nach höheren Werten ausdrückt. Es ist ein Wesen, das in sich selbst nicht eins ist, denn das aufwärts gerichtete Streben nach Licht und Reinheit und das schwer zu bändigende Naturwesen können nicht zusammenfinden. Sie können weder geeint werden, noch kann der eine Teil negiert, unterdrückt oder auf Dauer sublimiert werden, sie können nur nebeneinander, in gegenseitiger Respektierung bestehen. Diese Gespaltenheit zwischen Idealität und Realität im menschlichen Wesen verursacht bei vielen Menschen einen großen Leidensdruck. Sie haben angesichts ihrer Idealvorstellungen Mühe, den Körper zu akzeptieren, dessen natürliche Ansprüche und Bedürfnisse erfüllt und befriedigt werden müssen und wollen. Es sind Menschen, die ihr Ideal auf den Körper projizieren und durch ihn dann Anerkennung und Liebe suchen – der heute so verbreitete Jugendlichkeits- und Schlankheitswahn ist ein Ausdruck davon. Dies führt bei manchen, oft jungen Menschen zu einem ständigen Pendeln der Gefühle zwischen «himmelhoch jauchzend» und «zu Tode betrübt». Centaurium ist aufgrund seiner Wesenskraft des Bejahens dieser Gespaltenheit hilfreich bei psychosomatischen Krankheitszuständen der Verdauungsorgane, die sich aus einem solchen Leidensdruck entwickeln können. Dazu gehören vor allem Erkrankungen mit mangelnder Verankerung im Leiblichen wie z.B. die Magersucht, in deren komplexer Therapie Centaurium das pflanzliche Mittel der Wahl ist.»
WILDE KARDE
Dipsacus fullonum L.
Botanik
Dipsacus fullonum L., die Wilde Karde, ist eine immergrüne Halbrosettenpflanze. Unterirdisch bildet sie eine Pfahlwurzel mit einer schmutzig weißen Farbe aus. Aus der Wurzel entwickelt sich eine Rosette mit bis 30 cm langen, oval bis lanzettlichen Blättern. Diese Blätter sind relativ starr und an einigen Stellen stachelig. Bildet sich der leicht bestachelte Stängel, stirbt die Rosette meist ab. Der Stängel wird bis 2 m hoch und ist aufrecht. An ihm sitzen die ungeteilten Blätter, die tütenförmig verwachsen sind, so dass sie kleine Wasserreservoirs bilden. Auch die Stängelblätter sind bestachelt, vor allem auf der Unterseite. Später im Sommer wachsen aus den Blattachseln die breiten Blütenähren hervor. Diese Gebilde haben die Form eines Zylinders und beginnen von der Mitte des Köpfchens an mit lilafarbenen Blüten zu blühen. Die Blüte schreitet dann gleichmäßig nach oben und unten fort, woraus zwei Ringe offener Blüten resultieren.
Inhaltsstoffe
Zu den Inhaltsstoffen der Wilden Karde gehören unter anderem ätherisches Öl, Iridoidglucoside und Kaffeesäurederivate.
Verwendung
In der Homöopathie wird die Wilde Karde bei Hautleiden eingesetzt. In der Volksheilkunde unter anderem auch äusserlich bei Rhagaden und Warzen. Fallberichten zufolge wurde die Wilde Karde den Hinweisen aus der traditionellen chinesischen Medizin folgend, erfolgreich zur unterstützenden Behandlung der Borreliose eingesetzt. Der Einsatz erfolgte dabei in fortgeschrittenen Stadien (mehrere Jahre nach der Infektion), jedoch nicht zum Schutz vor Zeckenbissen und nicht zur Prävention einer Infektion nach einem Zeckenbiss. Da es bisher keine klinische Studie über die Wirksamkeit von der Wilden Karde bei Borreliose gibt, kann auf die Standardtherapie keinesfalls verzichtet werden.
SONNENHUT
Echinacea pupurea L. MOENCH
Botanik
Echinacea purpurea (L.) MOENCH, der rote Sonnenhut, ist eine ausdauernde Staude, die aus Nordamerika stammt. Die Pflanze erreicht mit einer Höhe von bis zu 1.80 m eine imposante Grösse. Ihre Blätter sind unten breit-eiförmig und werden nach oben zur Blüte hin eher breit-lanzettlich in der Form. Der Stängel ist nur leicht, die Blätter aber deutlich mit Borstenhaaren besetzt, was der Pflanze eine eher raue und kratzende Ausstrahlung verleiht. Dies scheint so gar nicht zu dem Bild der grossen ausdrucksstarken Korbblüten zu passen, die an der Spitze der Stängel stehen und in den Monaten Juni bis August erscheinen. Diese sind von den wunderbar rosaroten bis purpur farbenen Zungenblüten geprägt. Zu Beginn der Blütezeit stehen die noch grünen Zungenblüten zunächst senkrecht nach oben, im Laufe der Entwicklung erhalten sie die schöne Färbung und klappen dann um 180 Grad nach unten. Die Röhrenblüten, welche in der Mitte der Korbblüte stehen, werden von harten Spreublättern begleitet, die sich wie ein Igel anfühlen und dem Sonnenhut auch den Namen «Igelkopf» gegeben haben. Auch der lateinische Name «Echinacea» leitet sich vom griechischen Wort für Igel (echinos) ab. Im Laufe der Blühphase wölbt sich der zentrale Teil der Blüte immer weiter wie ein Kegel auf, was dieser ihre charakteristische Form gibt. In blühenden Beständen herrscht ein intensiver Besuch von zahlreichen Insekten, die als Bestäuber fungieren.
Inhaltsstoffe
Zu den typischen Inhaltsstoffen des roten Sonnenhuts gehören Kaffeesäurederivate (z.B. Cichoriensäure), Flavonoide, ätherisches Öl, Polyacetylene, Alkamide und Polysaccharide.
Verwendung
Die ursprünglich aus Amerika stammende Heilpflanze Echinacea purpurea (L.) MOENCH hat eine lange Tradition in der indianischen Medizin. Es verwundert deshalb nicht, dass die Anwendung von Echinacea-Präparaten schnell einen festen Platz bei den homöopathischen Ärzten in den USA erlangte. Die Echinacea-Pflanze fand schließlich ihren Weg nach Europa, wo sie heutzutage in großen Mengen für die Herstellung von Arzneimitteln kultiviert wird. Die Darreichungsformen sind vielfältig und reichen von Frischpflanzenpresssäften, Extrakten hin zu phytotherapeutischen und homöopathischen Tinkturen. Erkältungskrankheiten sind das Hauptanwendungsgebiet von Echinacea. In der Pflanzenheilkunde wird Echinacea für die Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen verwendet. Dies gilt als gut dokumentiertes, gesichertes Anwendungsgebiet. Auch homöopathisch wird Echinacea purpurea (L.) MOENCH unterstützend bei schweren und fieberhaften Infektionen verwendet.
Wesen und Signatur nach H. & R. Kalbermatten
Abschirmung, Eingrenzung, Schutzhaut
Signatur
«Das Blütenköpfchen des Sonnenhuts besitzt zur Mitte hin einen charakteristisch nach oben gewölbten Blütenboden. Ausserdem ist der braune, gewölbte Innenteil des Köpfchens mit stacheligen Borsten versehen, was ihm die Form und den Charakter eines Igels in der Abwehrhaltung verleiht. Dieses Merkmal gab der Gattung den botanischen Namen Echinacea (von griechisch echinos, Igel). Auch die englische Bezeichnung «Cone Flower» verweist auf den konisch gewölbten Blütenboden, ebenso wie der deutsche Namen «Sonnenhut» die einem Sombrero ähnliche Form der Blüte im mittleren Blühstadium beschreibt (siehe unten).
Die randständigen purpurnen Strahlenblüten vollziehen im Verlauf der Blütenentwicklung eine Bewegung um 180 Grad. Zu Beginn, bei der gerade aufgehenden Blüte, stehen sie senkrecht nach oben, sind noch schmal zusammengerollt, kurz und kaum gefärbt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Blütenboden noch nicht gewölbt. Später neigen sich die Strahlenblüten in die Horizontale und erreichen die volle Grösse und Farbe. In diesem Stadium beginnt sich der Blütenboden nach oben zu wölben und wird immer stacheliger. Jetzt hat der Blütenkopf die Form eines Sombreros. Daraufhin beginnen sich die Strahlenblüten nach unten zu neigen, bis sie bei der vollen Blüte senkrecht nach unten stehen und sowohl den Kelch als auch den Blütenstiel beschirmen. Bemerkenswert ist, dass sich der Blütenkelch durch diese Geste der Strahlenblüten vor den Blicken verbirgt. Der Kelch ist das Äusserste oder die Haut einer Blüte, weil er am Beginn einer Blütenexistenz die Hülle der Knospe bildet.
Mit den strahlenden, purpurfarbenen Kronblättern und der hochgewölbten Mitte der Blütenköpfchen ist der Sonnenhut eine schöne, stolze Blume. Ihr Duft ist leicht, unaufdringlich und dabei sehr differenziert und edel. Fernab von jeder Schwere oder Süsslichkeit vermittelt dieser Duft etwas Abgehobenes.
Der beim Anblick und Riechen erahnte Charakter der Unnahbarkeit bestätigt sich bei der Berührung. Neben der igeligen Borstigkeit des Blütenbodens drückt sie sich in der rauhhaarigen, kratzenden Oberfläche von Blättern und Stengel aus, die man der wohlgestalteten Pflanze zwar nicht ansieht, bei Berührung aber deutlich bemerkt. Auch dieses Merkmal unterstreicht eine Pflanzenpersönlichkeit, die auf Abschirmung bedacht ist und nichts an sich herankommen lässt.
Zerkaut man ein Wurzelstück, eine Blüte oder ein Blatt der Pflanze, oder nimmt man einige Tropfen der Urtinktur direkt auf die Zunge, bemerkt man einen etwas scharfen Geschmack, der ein pelziges Gefühl und eine leicht anästhesierende Wirkung hinterlässt. Es handelt sich dabei um die Wirkung der Isobutylamide, einer Klasse von Inhaltsstoffen, die in allen Pflanzenteilen in unterschiedlicher Konzentration vorkommt.
Abschirmung und Unnahbarkeit sind die Wesensmerkmale, die wir in den Gestaltungskräften der Pflanze erkennen können. Ein solcher Charakter lässt sich unschwer mit der bekannten Stärkung des körpereigenen Abwehrsystems durch Echinacea-Extrakte in Verbindung bringen. Das Immunsystem ist der biologische Abwehrmechanismus, der die Krankheitserreger am Eindringen, der Vermehrung und Ausbreitung hindert. Das Funktionsprinzip des Immunsystems heisst also Abschirmung, damit uns die pathogenen Mikroorganismen nicht zu nahe kommen.
In diesem Bereich entfaltet Echinacea auch ihre psychische Wirksamkeit. Ihre auf Abschirmung und Unnahbarkeit ausgerichtete Wesenskraft unterstützt unsere Seele darin, belanglose Angriffe und Reizsituationen an uns abfliessen oder abprallen zu lassen. Das Wesen von Echinacea verleiht uns in gewissem Sinne eine Schutzhaut, ein Panzerhemd oder eine Ritterrüstung und hält dadurch alle Pfeile von uns fern. Sie hilft uns, das Unwesentliche übersehen zu können, nicht wahrzunehmen, zu übergehen. Genauso wie das Immunsystem andauernd unzählige Erreger ohne unsere bewusste Mitwirkung von uns fernhält, ignoriert die lebenstüchtige Psyche die seelischen Erregersituationen, die für uns im Moment nicht aktuell sind. Dabei wirkt Echinacea unterstützend.»
Wesen
«Es ist das Wesen von Echinacea, uns mit einer Schutzhaut, einem Schild zu beschirmen, an dem potenzielle Konfliktauslöser abprallen. Infektionskrankheiten entstehen aus dem Zusammenspiel der drei Faktoren: Erreger, körperliche Abwehr (Immunsystem, Milieu) und psychische Abwehr. Da Erreger immer vorhanden sind, ohne dass es deshalb zu einer Infektion kommen muss, liegt der Schlüssel bei der Abwehr. Die Bedeutung des Immunsystems und des Milieus ist allgemein bekannt, doch die psychische Beeinflussung des Immunsystems ist nicht zu unterschätzen. Eine Abwehrschwäche wird oft durch eine Konfliktsituation ausgelöst. Dabei ist es wichtig, zwischen schwächenden und stärkenden Konflikten zu unterscheiden. Konflikte sind dann stärkend und müssen durchlebt werden, wenn sie zu einem Bewusstwerdungsprozess beitragen, wenn es zum Beispiel um die Abgrenzung gegenüber psychischer Ausbeutung geht. Sie sind aber schwächend, wenn ihnen ein nichtiger Anlass zugrunde liegt, wenn man sich ereifert, ärgert oder streitet über Dinge, die einen entweder nichts angehen oder die so unbedeutend sind, dass sie besser ignoriert würden. Oft entzünden sich Konflikte in Stresssituationen (Überlastung mit Arbeit und Problemen, Schlafmangel, nasskaltes Wetter). Dann kann der geringste Anlass zum Auslöser werden. Daher ist es notwendig, eine psychische Immunität gegenüber den vielen kleinen Unvollkommenheiten des Lebens zu entwickeln, sie zu ignorieren. Dabei unterstützt uns die Wesenskraft des Sonnenhuts. Echinacea umhüllt uns sozusagen mit einer Schutzhaut, die uns abschirmt und dasjenige zusammenhält, was sonst in die Trennung und damit in den Konflikt fallen würde.»
MEDIEN UND LITERATUR
Hier finden Sie eine Auswahl von Medieninhalten, die thematisch mit Ceres zusammenhängen. Die Inhalte sind nach den Typen Video und Literatur kategorisiert – ein Klick auf eine Kategorie öffnet die Liste mit den Inhalten.
/ Urtinkturen vom Spezialisten (Pascal Kalbermatten)
/ Oxidation during Fresh Plant Processing: A Race against Time
(Didier Barmaverain, Samuel Hasler, Christoph Kalbermatten, Matthias Plath, Dr. Roger Kalbermatten)
/ Die Bedeutung des Aufschliessens im Mörser bei der Herstellung von Ceres-Urtinkturen (Dr. Roger Kalbermatten)
/ Studien der Ceres Heilmittel AG zur Tinkturenqualität (Matthias Plath, Dr. Roger Kalbermatten)
/ Ceres Firmenportrait (Matthias Plath)
/ Pflanzliche Wirkstoffe zwischen Raum und Zeit (Dr. Roger Kalbermatten)
/ Die Herstellung der Ceres-Urtinkturen im Lichte der Homöopathischen Arzneibücher von 1872 (Dr. Roger Kalbermatten)
/ Herstellungstraditionen in der Phytotherapie (Dr. Roger Kalbermatten)
/ Information und Lebensenergie bestimmen den Wirkungsgrad (Dr. Roger Kalbermatten)














































